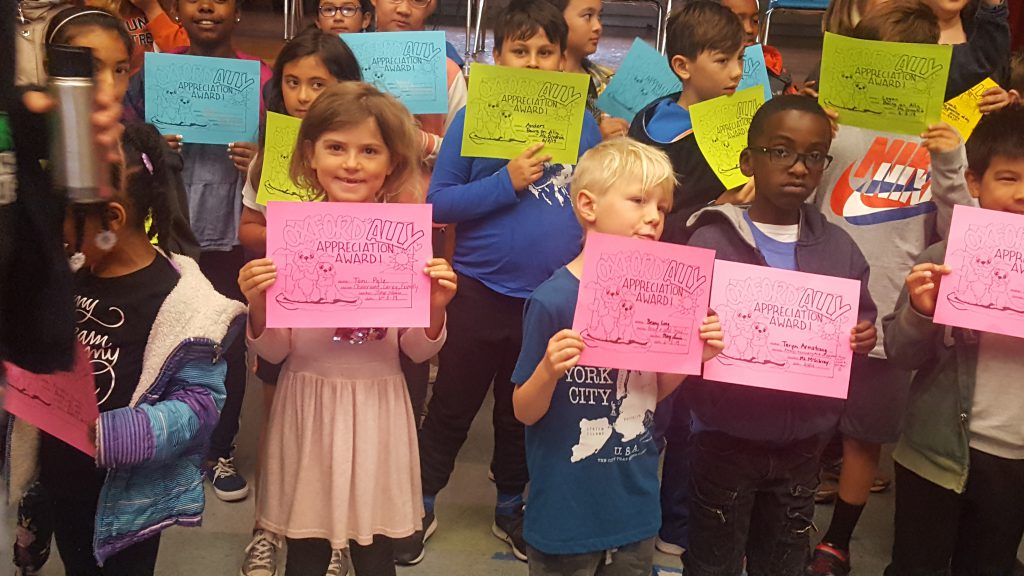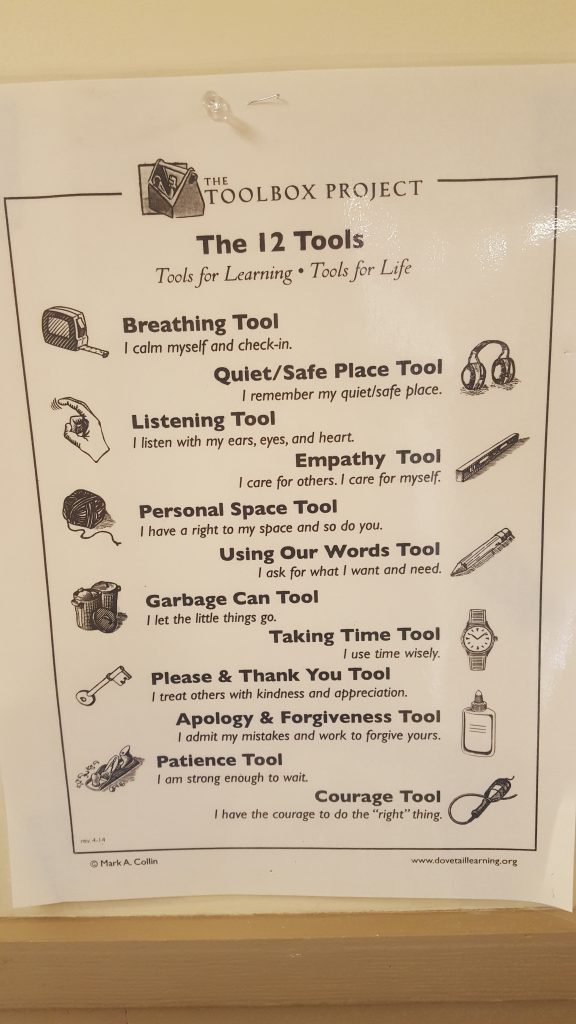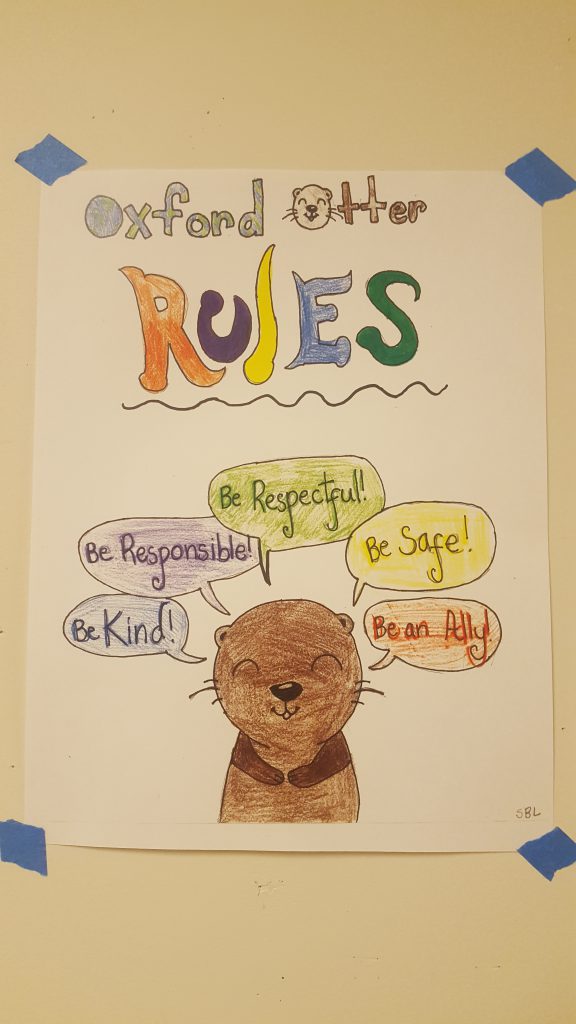Bei der letzten Elternbeiratssitzung des Schuljahres ging es
heiß her. Als offizielle Parliamentarian muss ich auf die Einhaltung der Regeln
pochen, die Uhr im Blick behalten und für Fairness sorgen. Gute Übung für
kommenden mind. 350 Kirchenvorstandssitzungen in meinem Leben.
Stein des Anstoßes war die Frage des Ortes für das
„Back-to-school-picknick“ Ende August. Die letzten Jahre fand es stets im San
Pablo Park statt. Ein großer Park samt Spielplatz im Süden Berkeleys. Also
dort, wo Menschen wie wir wohnen, die sich keine Villa in den Hügeln leisten
können. Mittelschicht, Arbeiter, Arme, mehr Schwarze als Weiße. Unsere Schule
ist im Villenviertel. Die Kinder kommen aber per Schulbus aus ganz Berkeley.
Im San Pablo Park zu feiern ist also mehr als eine Party. Es
ist ein politisches Zeichen: Wir (Reichen, Weißen) kommen zu euch (Armen,
Schwarzen). Für Fairness und Gerechtigkeit.
Der Park steht auch für Gewalt am hellerlichten Tage. In den
vergangenen Jahren gab es dort Schießereien, Hüpfburgen wurden getroffen,
Eltern drückten ihre Kinder auf den Boden. In den Fenstern angrenzender Häuser
landeten Kugeln.
Seitdem gibt es nicht wenige Familien, die diesen Park
meiden. Unter ihnen Freunde von uns. Also setzte ich mich im Elternbeirat dafür
ein, das Picknick in einem anderen Park zu veranstalten. Für Inklusion.
Unser afro-amerikanischer Präsident Daryl nahm diesen
Vorstoß sehr emotional auf. Ich dachte mir nichts weiter dabei, kenne ihn
bisher kaum. „Vielleicht ist das einfach seine Art?“ Nach hitziger Debatte
stellten wir fest: Im San Pablo Park ist an dem Tag schon eine
Großveranstaltung der Stadt, wir müssen uns einen anderen suchen. Thema
erledigt.
Nach der Sitzung kam Daryl nochmal auf mich zu: „Ich wollte
nur, dass du weißt, dass ich nicht denken, dass du ein Rassist bist.“ Ich
guckte ihn verwirrt an: „Wieso sollte ich denn ein Rassist sein?“ Und dann begann
ein 15-minütiges Gespräch, an dessen Ende wir beide viel gelernt hatten.
Er: „Du willst nicht in dem Park feiern, weil du Angst hast
vor Menschen wie mir.“
Ich: „Hä?“
Er: „Vor schwarzen Menschen.“
Ich: „Oh, ich hatte gar nicht daran gedacht, dass die schwarz
sind. Ich hab nur an ihre Waffen gedacht.“
Er: „Weil du sie nicht als Menschen siehst.“
Ich: „Doch, klar seh ich sie als Menschen.“
Er: „Nein, dann würdest du auch sehen, dass sie schwarz
sind. Oder siehst du keine Farbe? (ACHTUNG schwerer Vorwurf der
Colorblindness!!)“
Ich: „Ich sehe natürlich die Hautfarbe. Aber ich lebe noch
nicht so lange in Berkeley. Seit Januar gab es da keine Schießerei. Deshalb hab
ich keine Berichte gelesen oder Fotos von Verdächtigen gesehen. Und mir gar
keine Gedanken darüber gemacht, ob das Schwarze oder Weiße waren.“
Er: „Aber du weißt doch, statistisch sind es fast immer
Schwarze, die schießen.“
Ich: „Ja, das weiß ich. Aber das heißt doch nicht, dass es
immer so ist.“
Er: „Nein. Trotzdem, die Leute haben Angst vor Menschen wie
mir.“
Ich: „Meine Freunde wohnen dort, sie haben schwarze Freunde.
Sie haben einfach nur Angst vor der Gewalt.“
Er: „Vor der Gewalt von Leuten wie mir. Und das zählt nicht.
Sie haben schwarze Freunde, die so sind wie sie. Gebildet.“
Ich: „Gebildet wie du, ja. Und sie haben Angst vor der
Gewalt von Idioten mit Waffen. Egal, welche Hautfarbe sie haben.“
Er: „Leider sind das meistens Schwarze in den USA.“
Ich: „Ja.“
Er: „Verstehst du, warum mich das Thema emotional so
betrifft?“
Ich: „Ja. Verstehst du, warum ich hier für Inklusion bin,
statt für ein politisches Zeichen?“
Er: „Nein. Wer nicht in den Park kommen will, schließt sich
selbst aus.“
Danach haben wir einander noch 5 Minuten lang versichert,
wie wichtig es ist, offen zu reden. Selbst, wenn man am Ende nicht einer
Meinung ist. Aber wenigstens wissen wir nun beide, dass ich keine Rassistin
bin. Immerhinque.