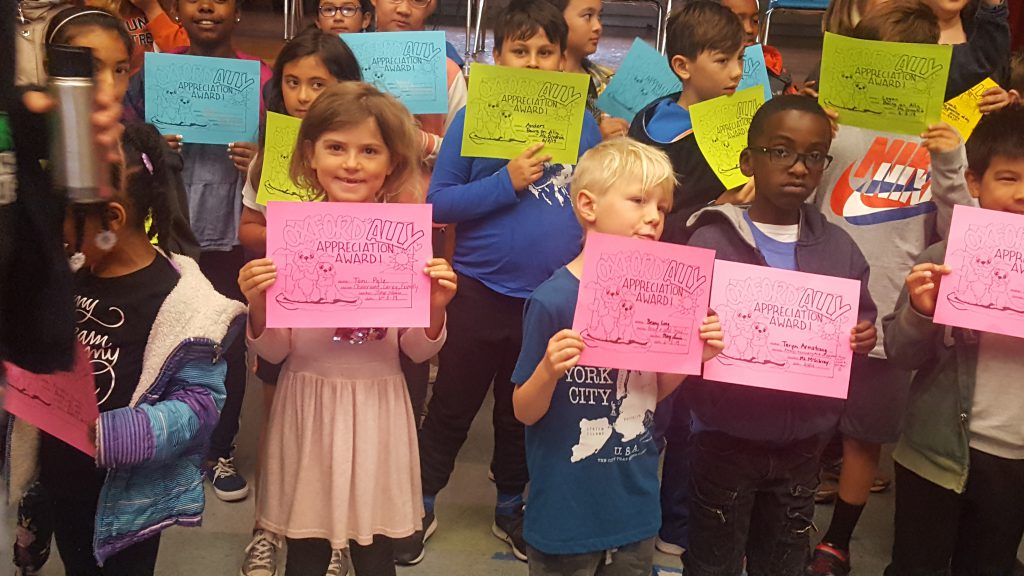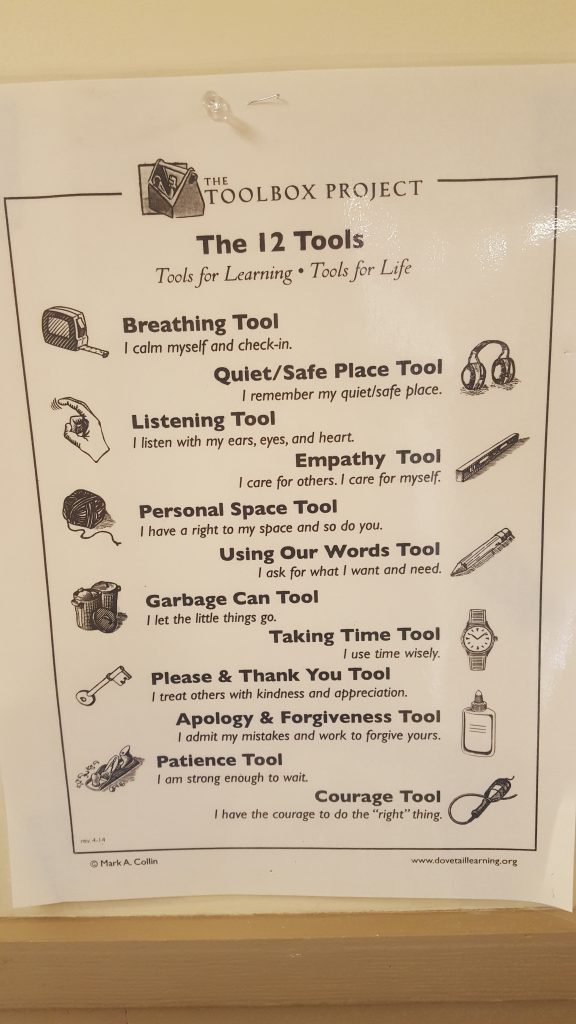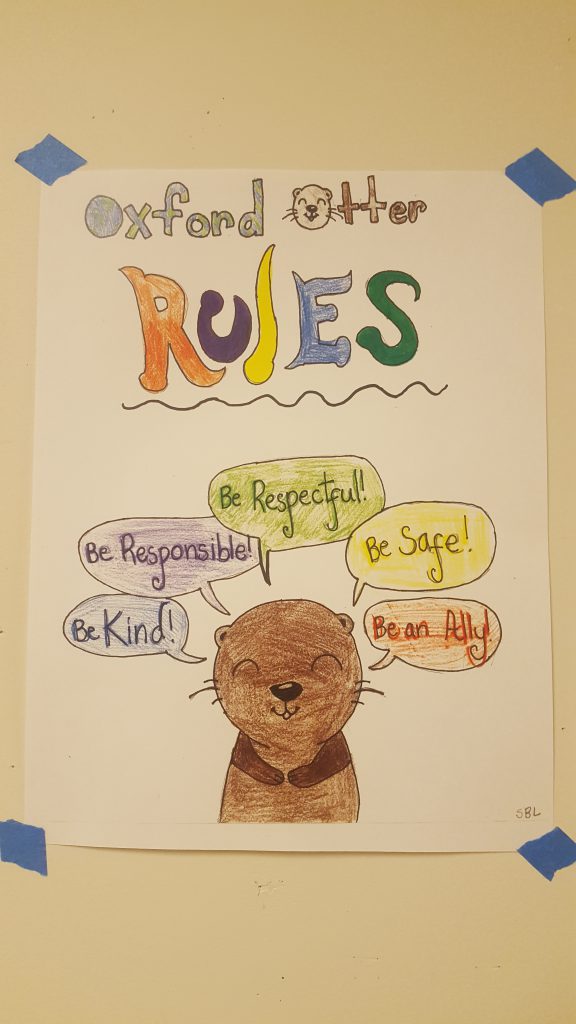„Jeden 2. und 4. Freitag im Monat laden wir alle unsere Nachbarn, Freunde und Bekannte zur Pizzaparty ein ab 17.00.“, schrieb eine Frau in einer Facebookgruppe. Und: „Wenn ihr auch eingeladen werden wollt, sagt Bescheid.“ Das ließ ich mir nicht 2x sagen.
Da war sie: unsere Partyeinladung von Menschen, die wir nicht kannten. An einem 2. Freitag radelten die Kinder und ich also einige Straßen weiter, klingelten an der Tür – und wurden wie alte Freunde begrüßt. „Kommt rein, guckt euch nicht um, ich hab nicht aufgeräumt.“
Die Gastgeberin konnte nicht wissen, dass schon dieser Satz mein Wohlgefühl weckte. Hier wird nichts versteckt, nichts extra hergerichtet. Eine 5-köpfige Familie lebt hier samt Hunden. Da ist das Chaos vorprogrammiert. Und niemanden stört es.
„Tut mir leid, dass wir zu spät sind.“, sage ich um 17.30. T. lacht. „Ihr seid die Ersten. Macht’s euch gemütlich.“ Die Kinder verschwinden sofort in die 2 Kinderzimmer und T erzählt. Davon, dass sie schon immer diesen Wunsch hatte, regelmäßig viele Menschen einzuladen. Dass Pizza sich perfekt eigne. Jeder kann Belag mitbringen oder Desert oder Wein oder einfach sich selbst. Sie kaufen einfach riesige Mengen Käsetiefkühlpizza beim Großmarkt und füllen das Gefrierfach ihrer Nachbarn und ihr eigenes damit.
So wird der Abend zum „Slow-Food“-Erlebnis. Eine Pizza nach der anderen wird belegt und gebacken. Nach wenigen Minuten fühle ich mich dazugehörig. Wir reden über Jobs und Kinder, das Leben und Kirche. Denn viele der Anwesenden gehen in die episkopale Kirche. So viele Christen auf einem Haufen in Berkeley hatte ich noch nie. Die erste Stunde futtern die Kinder alles weg. Als sie endlich abegfrühstückt sind, dürfen wir Erwachsenen ran.
Und ich denke mir: So könnte Kirche sein. Jeden 2. und 4. Freitag im Monat gibt’s Pizza im Pfarrhaus. Kommt auf meine Wunsch- und To-Do-Liste. Wir freuen uns schon auf den 4. Freitag im Monat!