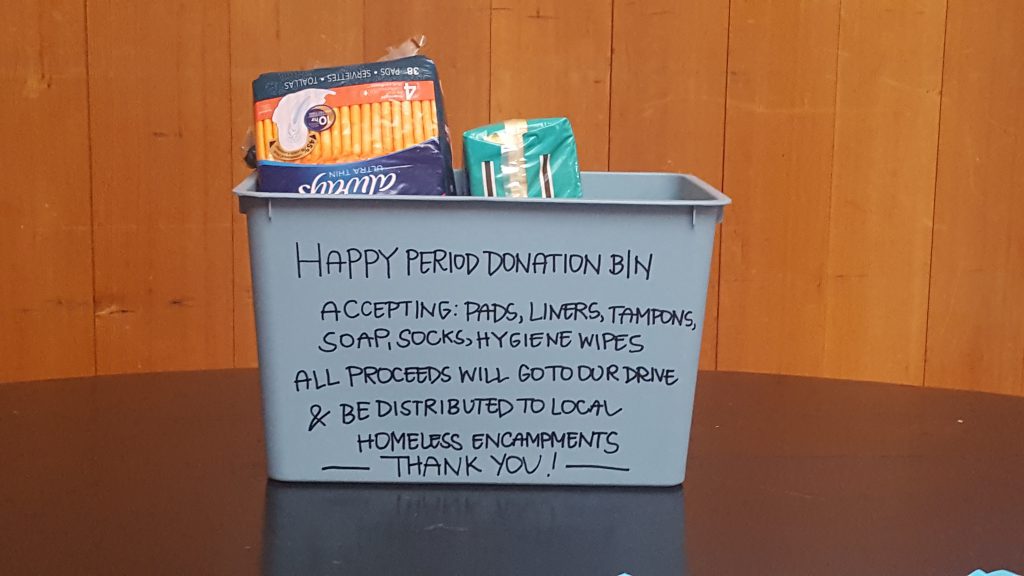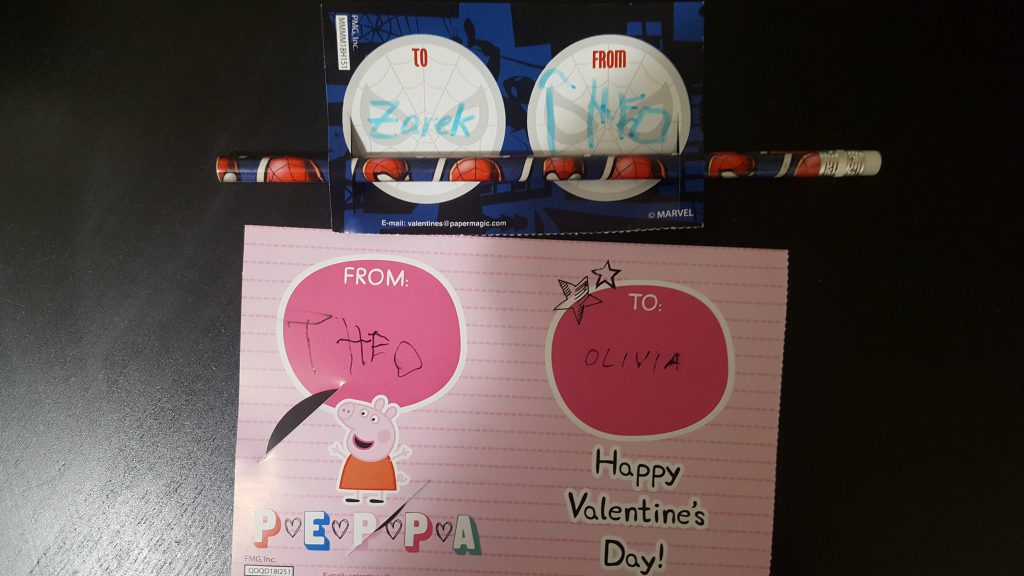Wenn ich Theo aus dem Kindergarten abhole, versuche ich möglichst wenig Kontakt zu den Erzieherinnen zu haben. Am besten Lächeln, Anziehen, Raus, Durchatmen!
Nein, ich habe keine Autoritätsphobie entwickelt. Aber ich mag es nicht, wenn mir schlechte Dinge über meine Kinder erzählt werden. Also, wenn Theo ein anderes Kind verprügeln oder anspucken würde, wüsste ich das schon gern. Aber, dass er ein Stück vorgelaufen ist beim Spazieren gehen und nicht gleich reagiert hat aufs Rufen, ist mir ehrlich gesagt egal. Da erwarte ich von Erzieherinnen Durchsetzungsvermögen, Autorität, Konsequenzen. Zur Not nonverbale.
Hier gilt hingegen das Prinzip „Petzen“. Strafe bedeutet: Ich sag es deinen Eltern. (Das hat mich als Kind schon nicht beeindruckt.)
Erzieherin: „Theo wollte sich heute nicht zudecken beim Schlafen. Und er ist aufgestanden während der Mittagsruhe und hat sich neue Bücher geholt.“
Ich: „Hm, ja. Theo, warum nimmst du keine Decke?“ (Ich denke: Ist das ihr Ernst? Ist doch vollkommen egal.)
Theo: „Mir ist zu warm.“
Ich: „Also Theo möchte keine Decke zum Schlafen, er schwitzt dann. Er schwitzt immer beim Schlafen.“
Erzieherin: „Ja, aber alle Kinder haben hier ihre Decke.“
Ich: „Ja, Theo mag sie nicht. Theo, warum bist du aufgestanden?“
Theo: „Ich wollte mir Bücher holen, ich hatte schon alle angeguckt.“
Ich: „Theo ist aufgestanden, weil er sich neue Bücher holen wollte“
Erzieherin guckt langsam unwirsch.
Ich: (merke, dass ich jetzt die Situation retten muss): „Aber ich sage Theo, dass er liegen bleiben muss und von ihnen neue Bücher bekommt.“
Ich demonstrativ zu Theo: „Theo, du musst liegen bleiben und warten. Du musst auf die Erzieherin hören.“
Theo: „Das ist blöd.“
Ich: „Ja.“
Ich (zur Erzieherin): „Ich habe ihm gesagt, dass er auf Sie hören muss, auch wenn er nicht mag.“
Erzieherin geht zufrieden weg.
Erst dachte ich, es läge an der Sprachbarriere. Dann erlebte ich letzte Woche folgende Szene. Zwei Mädchen saßen auf ihren Klappbetten und hatten partout keine Lust, diese aufzuräumen. Mary bat sie zum wiederholten Male. Sehr freundlich. (Hier wird NIE rumgeschrien oder auch nur die Stimme erhoben gegenüber Kindern. Der Ablauf ist: Freundlich, freundlich, petzen, freundlich, Kind landet vor der Tür.) Ich harrte der Dinge, die da kämen. Nichts geschah.
Demonstrativ ging Mary 10 Schritte zu ihrer Kollegin Kathy und sagte zu ihr: „X und Y wollen ihre Betten nicht aufräumen.“ Mary kam wieder zurück und erklärte den beiden Mädchen: „Ich habe euch bei Kathy verpetzt. Jetzt bekommt ihr Ärger.“ X und Y nahmen ihre Betten und trotteten zu Kathy.
Das Verrückte: Gefühlt herrschen viel mehr Regeln in der Kita . Dafür darf man mit Schuhen, auf Socken oder barfuß umherlaufen und während der Mahlzeiten aufstehen. Oberstes Gebot: Befolgen, was die Erzieher sagen.
Keine von Theos Stärken. Autoritäre Leitung ohne konseuquente Autorität. Irgendwie schwer ernstzunehmen, da muss ich Theo zustimmen.
Als ich das Erlebnis einer Bekannten erzählte, lachte sie nur und meinte: Das bleibt so! Wenn einer ihrer Mitarbeiter unzufrieden sei, wende er sich stets an die Personalabteilung. Die rufe dann bei ihr an und bringe die Beschwerde vor. Direkte klärende Gespräche seien höchst selten. Andersherum werde das von ihr auch erwartet, sie halte sich nur nicht dran.
In Theos Fall sind wir Eltern also die Personalabteilung. Nur dumm für die Kita, dass ich natürlich immer auf Theos Seite bin. Nun wurschteln wir uns so durch und überlegen zu Hause alle gemeinsam, welche Regeln Theo unbedingt einhalten muss. Und welche er wie klug umgehen kann.
Theos soziale Intelligenz wird definitiv trainiert. Als ihn letzte Woche ein Junge anspuckte, sagte er es den Erziehern. Der andere bekam Ärger. Alles gut. „Aber“, so Theo, „Jacob haut alle, den hauen auch alle zurück. Ich lass mich doch nicht verprügeln.“ Stimmt auch irgendwie. „Lass dich nur nicht erwischen, Theo!“ Theo grinst.