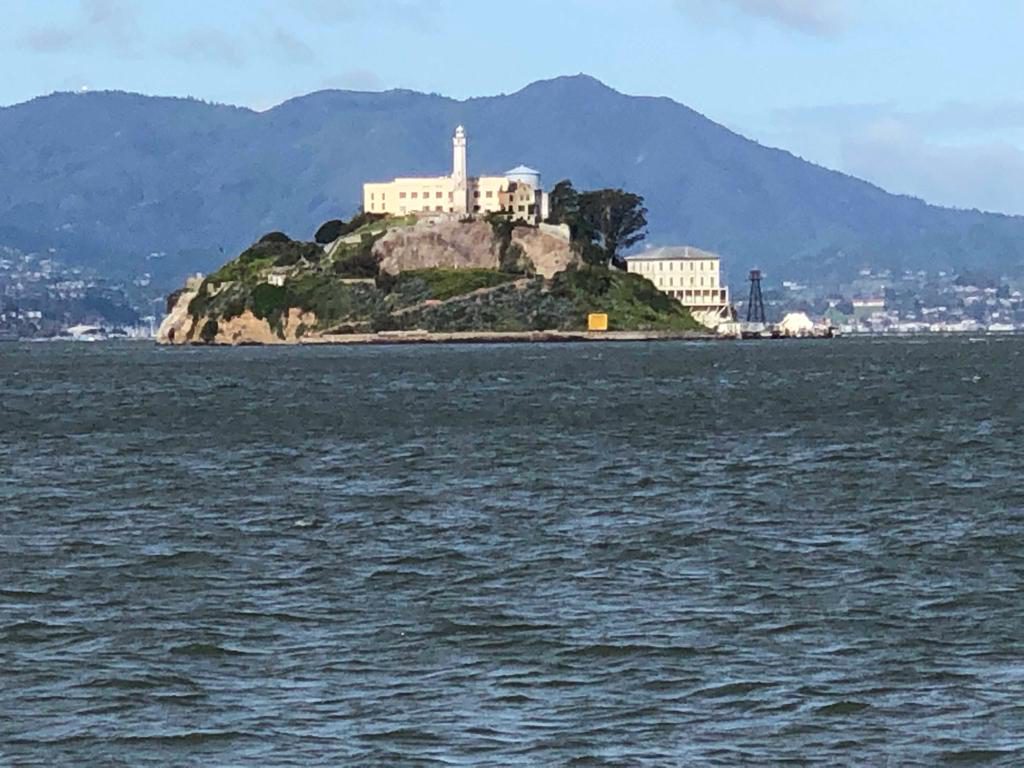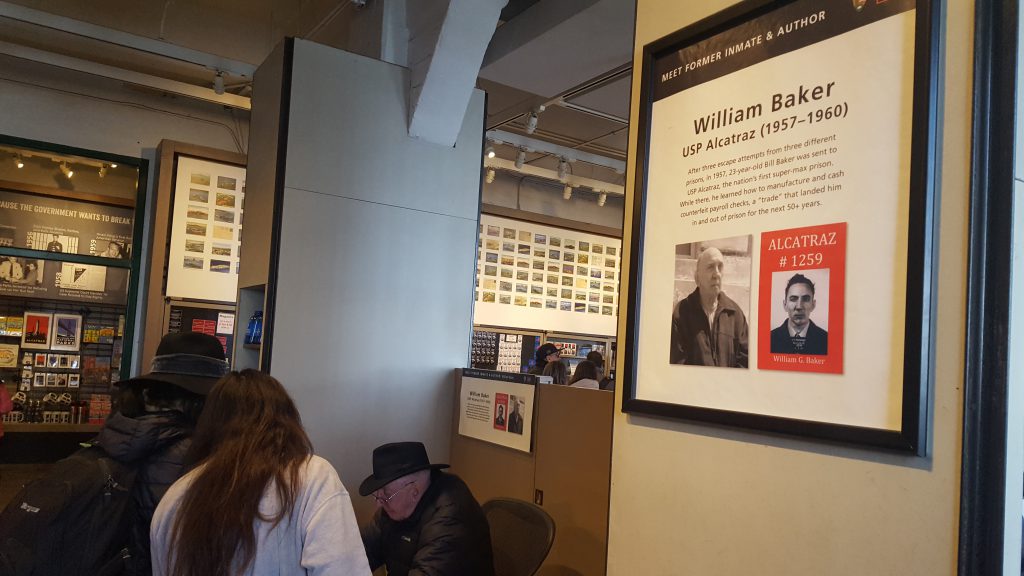Mitte Juni und endlich Sommer! Temperaturen über 30 Grad am Wochenende. Ab an den See. Lake Anza wurde uns empfohlen. Ein kleiner See im Naturschutzgebiet Tilden hoch über Berkeley. Er koste zwar Eintritt, dafür gebe es Sand und Schatten, Klos und Rettungsschwimmer.
Mit dem geliehenen E-Auto von Freunden quälten wir uns die steilste Straße Berkeleys hoch. Gefühlt rollten wir rückwärts. Abwärts ist die Strecke übrigens auch nicht harmloser. Es ist wie beim Skifahren auf der schwarzen Piste. Da sieht man die halsbrecherische Tiefe auch erst, wenn man schon auf dem Weg nach unten ist.
Gegen Mittag war das Freibad noch angenehm leer. Also raus aus den Klamotten, rein in die Badesachen. Theo mit Schwimmgürtel und Schwimmflügeln ausgestattet. Tonis Flügel vorsichtshalber mit ans Wasser genommen gegen erlahmende Arme. Und ab in den See.
Bis zur ersten Absperrung nach ca. 5 m = Hüfthöhe bei Theo! Bis hier dürfen alle Kinder und Eltern. Die nächsten 5m sind für Kinder von Eltern, die den Schwimmtest bestanden haben. Also marschierte ich zum ca. 18-jährigen Rettungsschwimmer und meldete mich zum Schwimmtest. „Du musst 15m kraulen, Kopf unter Wasser mit seitlicher Atmung.“ Oha, kann ich das noch? Hab ich mal gelernt in meiner Jugend, aber ewig nicht gemacht. Aber Blamage ist nicht drin. Ich drückte Toni meine Brille in die Hand und nahm die Herausforderung an. Hab sie auch gemeistert. Gut, ich schwamm schräg und zu weit, hab ja nichts gesehen ohne Brille, aber dass Abzeichen in Form eines Armbandes bekam ich überreicht. Puh.

Ich vermute, 60% der Deutschen würden diesen Test nicht bestehen. Aber hier in den USA lernt man als erstes Kraulen, nicht Brustschwimmen. Und Regel ist Regel.
Nun durfte Toni ihre Schwimmübungen unter meiner Aufsicht und den Augen von 6 (!) Rettungsschwimmern in hüft- bis halstiefem Wasser fortsetzen. 2 standen auf den Wachttürmen, 2 wateten im Wasser herum, 1 paddelte im 3 Bereich auf einem Board und 1 lief zwischen allen hin und her. Sie waren fast schon eine Planschbehinderung.
Auf der anderen Seite des Sees badeten einige ganz Wagemutige. Außerhalb des abgesperrten Bereichs. Also Megafone rausgeholt und reingebrüllt: „Es ist strengstens verboten… Verlassen Sie sofort das Gewässer.“ Und das Wunder: Die Leute gehorchten.
Alle 90 Minuten wurden alle Kinder unter 16 Jahren aus dem Wasser gescheucht. „15 Minuten Pause: Findet eure Familien, trinkt was, esst was, schmiert euch mit Sonnencreme ein und geht aufs Klo.“, lautete die detaillierte Anweisung. Blöd, wenn man gerade erst ins Wasser gegangen war. Austricksen ging nicht, denn: „Die 15 Minuten beginnen erst, wenn das letzte Kind das Wasser verlassen hat.“
Bei aller individuellen Freiheit, die Amerikaner so schätzen, ist ihre Hörigkeit gegenüber Autoritäten immer wieder erstaunlich. Regeln müssen eingehalten werden. Egal, wie absurd sie sind.
Nach einigen Stunden traf Theo seinen Kindergartenfreund Ashton. Nach wenigen Minuten waren sie im schönsten Wasserpistolenkampf. „Bis zur ersten Absperrung darfst du gehen“, rief ich ihm zu und blieb mit Toni, die sich gerade aufwärmen musste, am Ufer stehen. Einige Minuten später kam ein aufgebrachter Rettungsschwimmer auf mich zu. Ich müsse mich in der Nähe meines Kindes aufhalten! Am besten direkt neben ihm.
Nun stiefelte ich dem davon sichtlich genervten Theo hinterher durchs Wasser, wurde ständig „aus Versehen“ nass gespritzt und drehte mich alle paar Sekunden nach Toni um, die nun „unbeobachtet“ spielte. So entspannt hatte ich mir meinen Samstag vorgestellt. Während Theo seine Pistole lud, stand ich 2 Schritte hinter ihm, ein Rettungsschwimmer 4 Schritte neben ihm. Sicherer geht es nicht. Bis ein weiterer Rettungsschwimmer auftauchte. Mit Tunnelblick ging er auf Theo zu, ignorierte mein Winken und fragte „Wo ist deine Mama?“ Ich wedelte hysterisch mit den Armen. Er sah mich. Allgemeine Erleichterung.
Selbst unsere Schwimmflügel wurden mokiert. Ob ich meinem Kind nicht sicherere Schwimmhilfen geben wolle? Aus Styropor? Die hier könnten platzen und dann würden die Arme der Kinder hoch gerissen (wieso eigentlich nicht runter?) und sie würden jämmerlich ertrinken (im knietiefen Wasser). Wir könnten die sicheren Hilfen kostenlos ausleihen. Ein Blick zu Toni, sie nickte, ok, dann machen wir das. Schwimmflügel ausziehen, Styropor-Flügel-Westen-Kombination anziehen. Zu klein. Na, wir haben guten Willen bewiesen.
Toni fand alles witzig und machte sich eine Spaß draus. Sie „schwamm“ zur ersten Absperrung und zappelte dann wie wild herum. Philipp fand es unterhaltsam, der Rettungsschwimmer nicht.
Fazit: Da fahren wir nicht wieder hin. Oder erst nach 18.00. Dann hat die Seenotrettung Feierabend. Und der Eintritt ist frei.