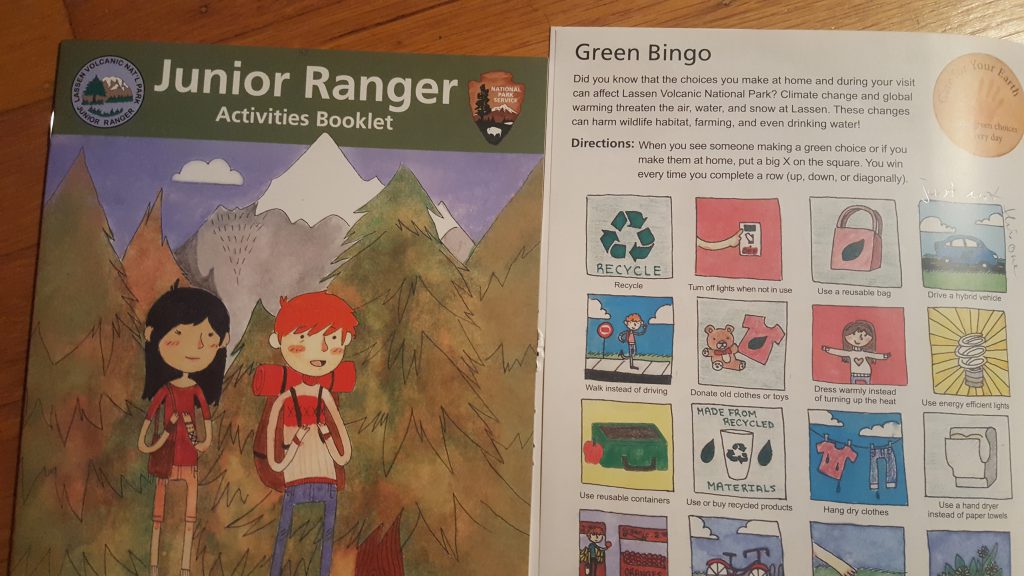Für meine Fortbildung als Krankenhausseelsorgerin brauche ich einen Tuberkulose-Test. Also einen Nachweis, dass ich keine Tb habe. Diese Krankheit, von der ich bisher immer dachte, nur Opernfiguren hätten sie.
Also vereinbare ich einen Termin bei der mir zugewiesenen Hausärztin. Stellt sich heraus, sie spricht deutsch, hat 2 Jahre in München gelebt mit Mann und Kindern. Guter Start.
Ein Stapel Formulare wird mir gereicht mit Infos über meine Krankheitsgeschichte, ziemlich detailliert. Ahnen werden bis zu den Großeltern abgefragt. Eine Patientenverordnung gibt’s ungefragt gleich dazu. „Bitte ausfüllen so bald es geht und unter Zeugen unterschreiben.“ Ich habe mal wieder das Gefühl, dass sich in Amerika eine ziemlich bevormundende Fürsorge mit der totalen Freiheit, diese komplett zu verweigern, mischt.
Ärztin: „Wann hatten Sie denn ihren letzten Gesundheitscheck?“
Ich: „Hm, das macht man in Deutschland erst ab 35. Davor geht man zum Arzt, wenn man krank ist.“
Ärztin: „Oh (denkt sich wahrscheinlich wie hinterwäldlerisch Deutschland ist). Dann machen wir das gleich mal.“
Ich werde also von Kopf bis Fuß untersucht, mein Impfpass wird studiert (einiges fehlt, wird gleich mal aufgefrischt) und dann werde ich ins Labor geschickt. Großes Blutbild machen lassen. Denn: „Sie sehen zwar soweit gesund aus, aber ich kann ja nicht in Sie hineingucken.“ Stimmt eigentlich.
Als Kind hatte ich eine regelrechte Nadelphobie. Habe bei ihrem Anblick gebrüllt bis ich Herpes bekam, habe Nadeln verbogen und mich weggewunden. Dank der Schwangerschaften benehme ich mich inzwischen „erwachsen“. Hasse es aber immer noch. Bis jetzt. Denn die Schwestern hier im Labor sind echte Nadelfeen. Sie machen den lieben langen Tag nichts anderes als Blut abnehmen. Und das merkt man. Bzw. merkt es eben nicht. Weder den Einstich, noch das häufig ruppige Rausziehen. Kein blauer Arm danach, kein Bluterguss. Hier geh ich gern wieder hin!
Begeistert bin ich auch vom Prinzip „Ärzthaus“ hier. Es ist kein Gebäude, in dem zufällig viele Ärzte ihre Praxen haben. Nein, der ganze Komplex ist eine logistische Einheit. Die Daten aller Patienten sind für die behandelnden Ärzte und Schwestern überall zugänglich. Hausärzte, Fachärzte und Notaufnahme sind unter einem Dach.
Am Willkommenstresen meldet man sich an und zahlt die Praxisgebühr. Hier kann man sich Arztbriefe ausdrucken lassen und Gesundheitsinfos. Für Impfungen und Blutwerte geht’s direkt zur Schwester. Zu Ärzten geht man ausschließlich mit Termin. Wartezeiten von 15 Minuten sind schon unverschämt lang… Arztbesuche können soooo angenehm sein!
Achso, mit dem Rad brauche ich 8 Minuten dahin.