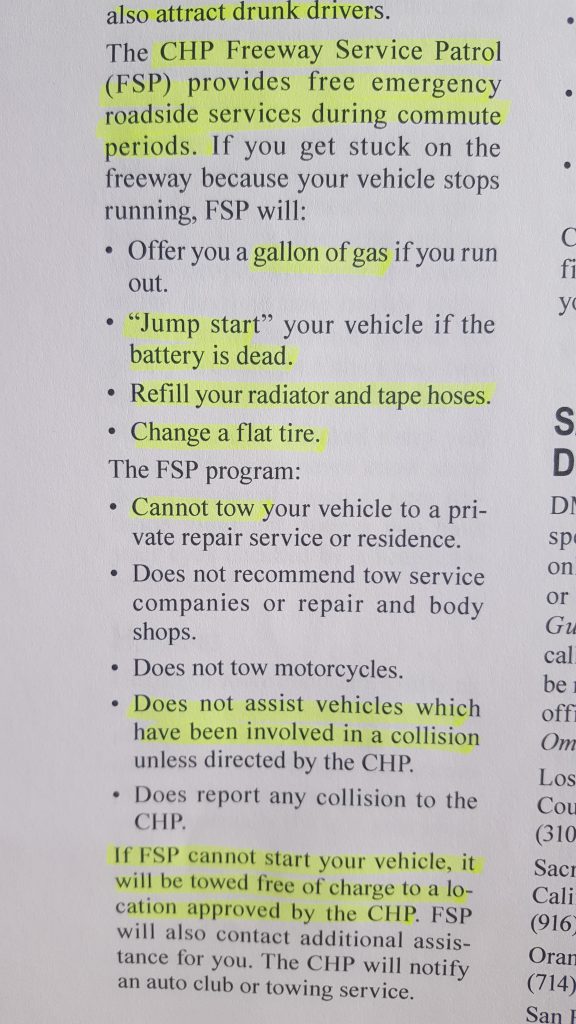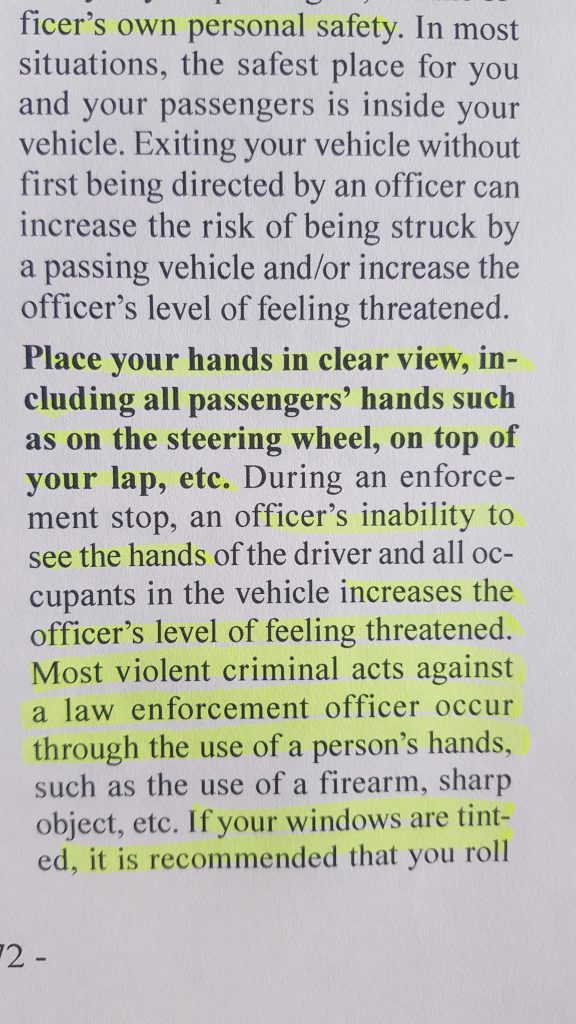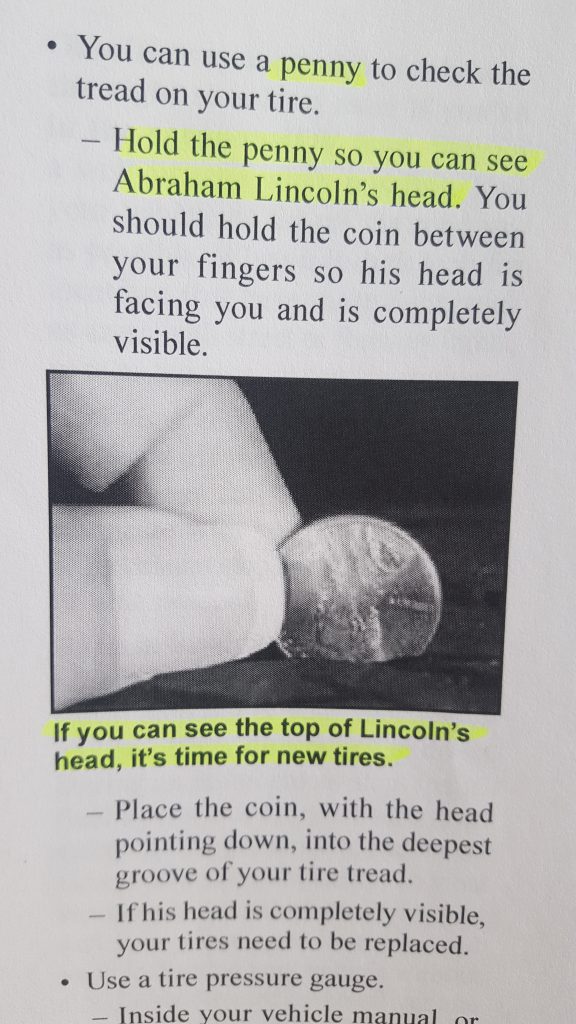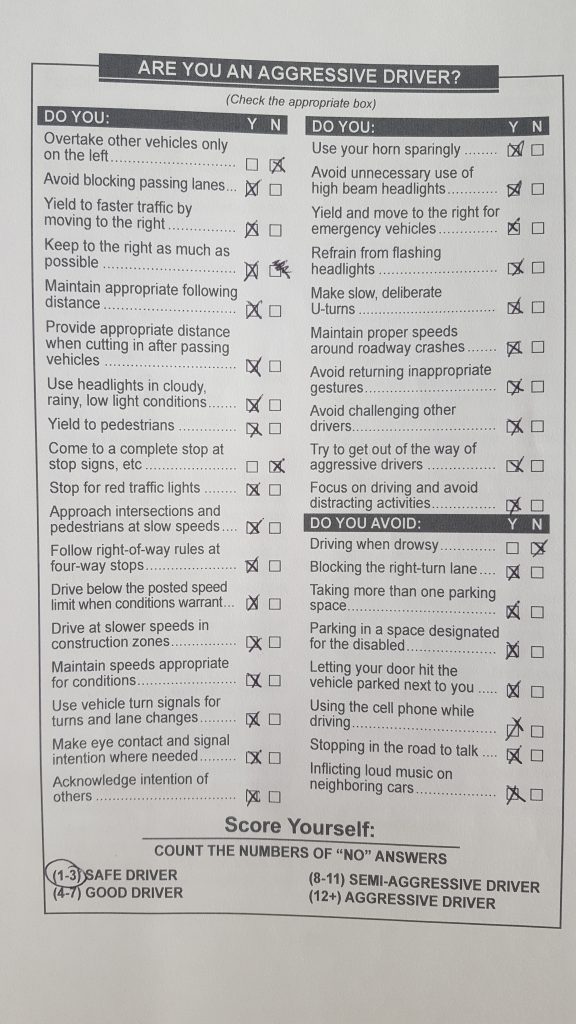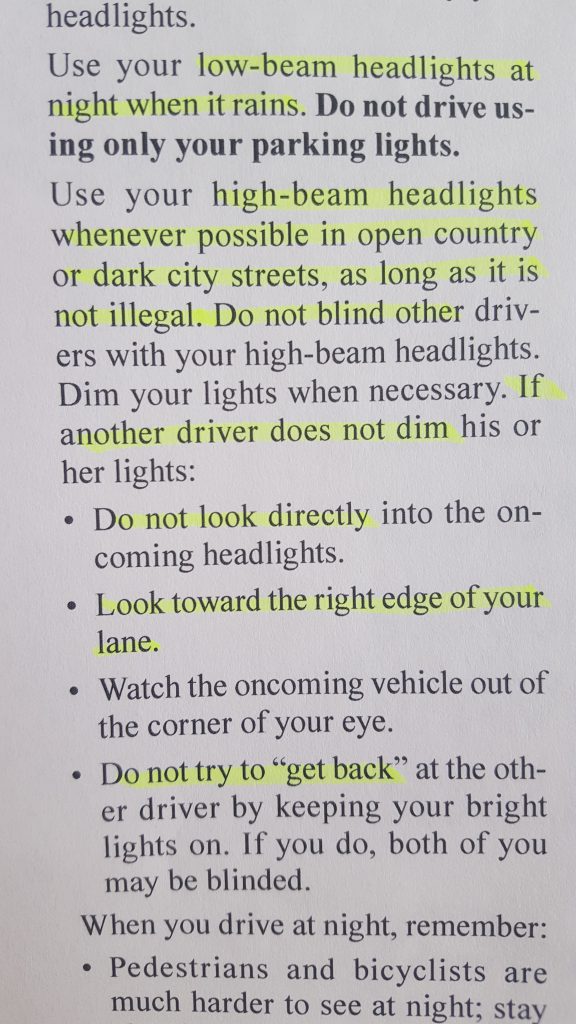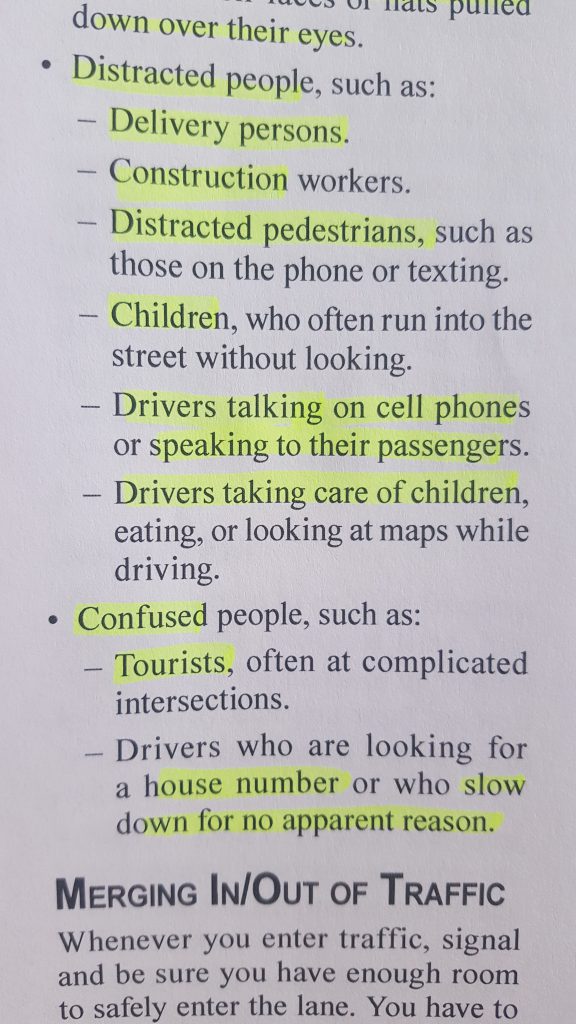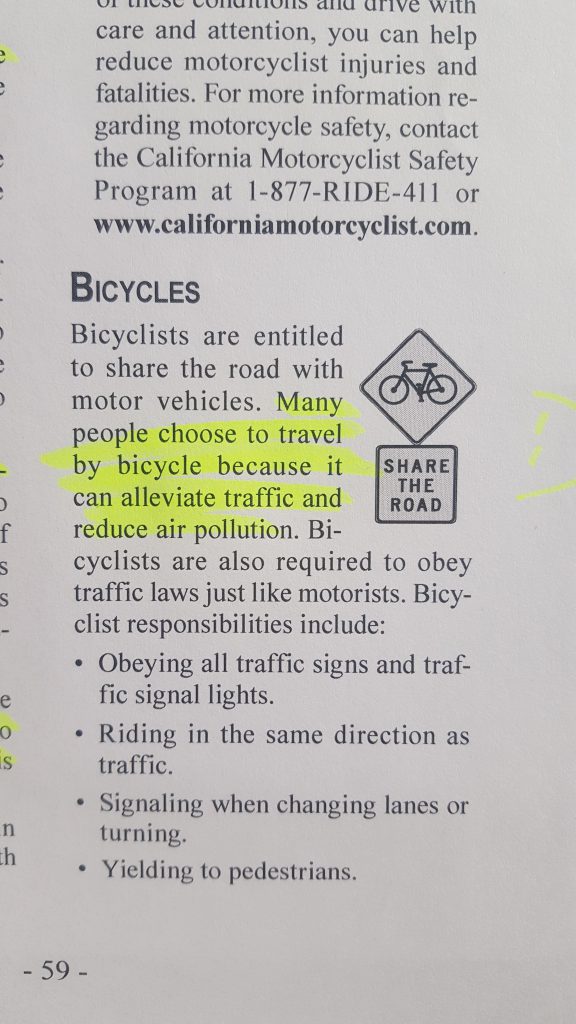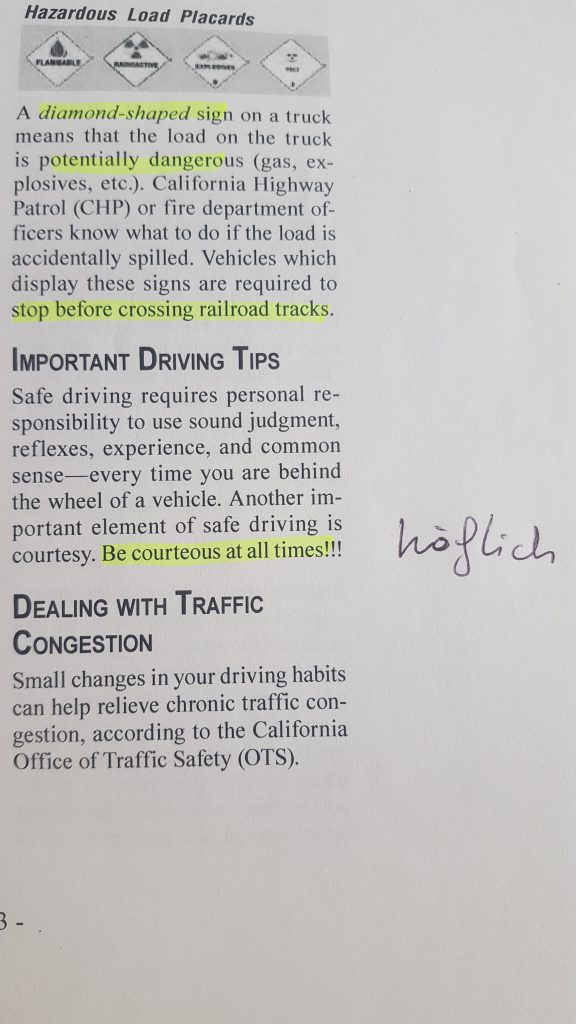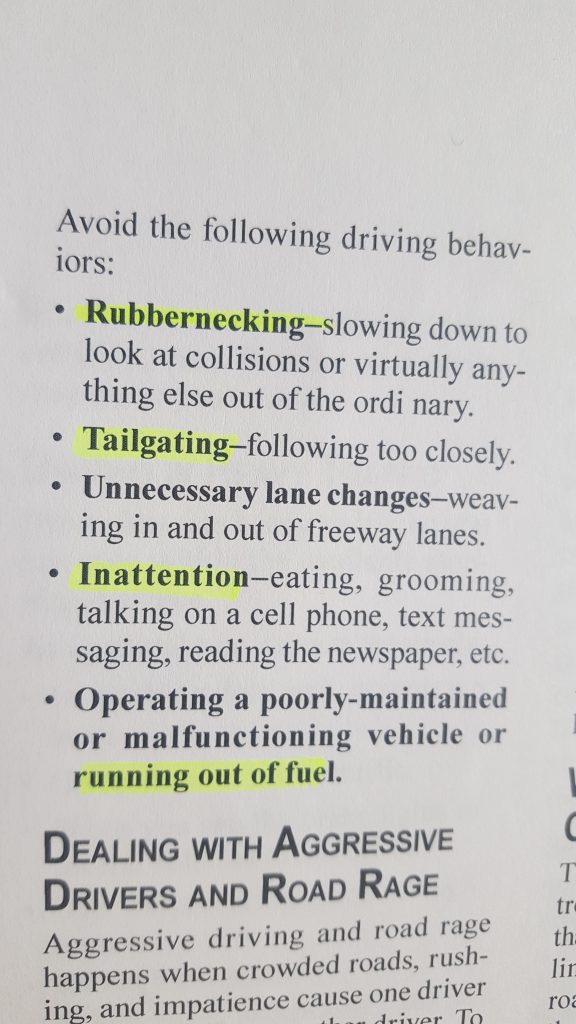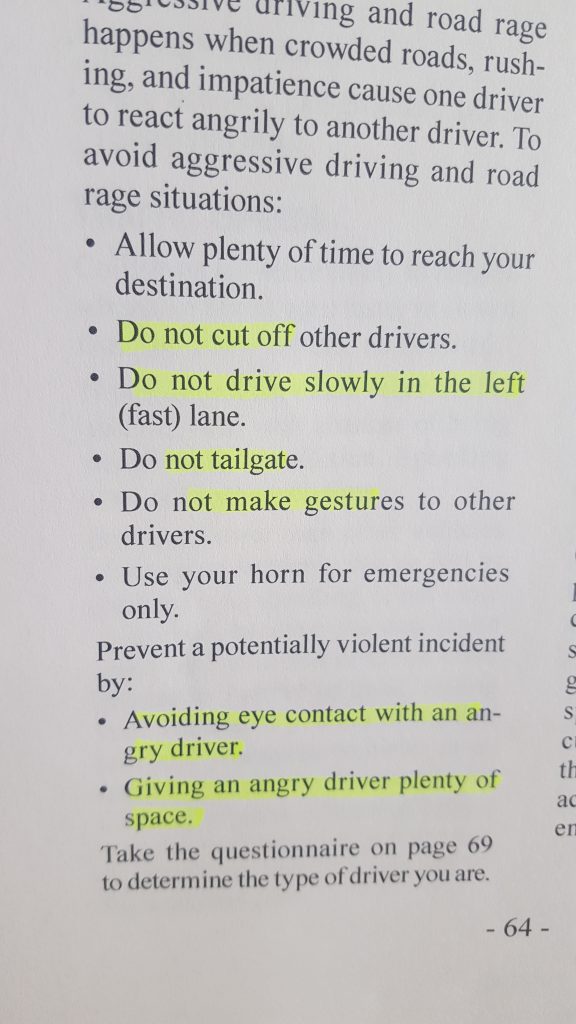Heute habe ich Leah auf dem Spielplatz getroffen. Ihr Sohn Theo ist 6 und geht in Berkeley in die 1. Klasse. Es hätte ein ganz alltägliches Gespräch sein können. Aber Leah und Theo sind seit 5 Jahren obdachlos. Im Moment zelten sie in der Nähe unseres Lieblingsspielplatzes. Da ist es sicher, die Nachbarn kennen sie, viele Familien gehen ein und aus. Ein Bach mit frischem Wasser fließt entlang zum Waschen, Trinkwasser und eine Toilette sind auch vorhanden. Die beiden stören hier niemanden.
Trotzdem kam gestern mal wieder Polizei vorbei. Drohte mit Strafen (die Leah sowieso nicht zahlen kann) und schlug ihr vor, mit ihrem Sohn an die Autobahn zu ziehen. Da leben viele Obdachlose in Berkeley. Es ist laut, dreckig von den Abgasen. Und lebensgefährlich schmutzig, weil die Menschen auf der ehemaligen Deponie zelten. Das tue sie ihrem Sohn nicht an, sagt Leah.
Strafen seien ihr egal. Ihre einzige Sorge ist, dass sie festgenommen werde und ihr dann ihr Sohn weggenommen werde. Das will sie um jeden Preis verhindern. „Aber die Polizisten sind auch Menschen und Väter. Sie machen ihren Job und haben Mitleid mit mir.“
Wir kommen ins Gespräch, weil Leah sich mit einer anderen Frau unterhält und anfängt zu weinen. Ich gehe hinüber, die Seelsorgerin in mir kann nicht anders. Ihre Geschichte bringt mich auch zum Heulen.
Leah ist während der Schwangerschaft erkrankt, seitdem ist sie offiziell schwer behindert und arbeitsunfähig. Ihr Mann missbrauchte und schlug sie. Um ihren kleinen Theo zu schützen, verließ sie die gemeinsame Wohnung. Von ihrem Ersparten wohnte sie in Motels bis das Geld alle war. Dann zog sie ins Zelt, radelt durch die Stadt, transportiert Theo im Fahrradanhänger. Und ich denke mir: Genauso würde ich es auch machen. Im letzten Winter wurden beide so krank, dass eine befreundete Familie ein GoFundMe initiierte. Innerhalb weniger Tage kamen 15.000 Dollar zusammen und sie konnte wenigstens bis zum Sommer in Motels leben. Für eine Wohnung reichte es nicht. Dafür braucht man entweder einen Arbeitsvertrag oder einen Sozialschein von der Stadt Berkeley. Ja, so was gibt es. „Aber den unterschreiben sie mir seit Jahren nicht.“
Leah kämpft um ihr Kind. Sie weiß um ihre Rechte als Mutter und dass ihr Theo nicht einfach weggenommen werden darf. Angst hat sie trotzdem. Sie kämpft gegen Berkeley für ihr Recht, kennt die Gesetze. Hat aber keinen Anwalt. Ich bin leider auch keine Anwältin. Aber ich kenne Leute in Berkeley und vielleicht kennt ja jemand wen, der jemand kennt?
Ich habe jetzt Leahs Handynummer und Email. Versprechen konnte ich ihr nicht viel, außer, dass ich mal Freunde und Bekannte frage. Ob nicht irgendjemand einen Anwalt kennt, der sich ihres Falles annimmt. Wahrscheinlich ohne Entlohnung, vielleicht mit Pflichtverteidigergehalt. Für eine wirklich gute Sache, für das Leben zweier Menschen.
Leah versteckt sich nicht. Sie schämt sich nicht. Wofür auch? Leah sucht die Öffentlichkeit, denn das ihre einzige Chance, etwas zu verändern. Demnächst erscheint eine große Reportage über sie im „Guardian“, einer Zeitung. Sie sagt: „Ich denke immer noch jeden Tag, dass das nicht wahr ist. Dass mir das nicht wirklich passieren kann. Aber es ist wahr.“
Täglich bewirbt sie sich um Wohnungen. „Aber ohne Zettel vom Amt bekomme ich nichts.“
Und Theo? Er geht unterdessen in die Schule, bekommt dort Frühstück und Mittagessen und Snacks zum Nachmittag. Lehrer und Eltern helfen, wo sie können.
„Weißt du, was das Verrückteste ist?“, fragt mich Leah. „Laut offiziellem Zensus gibt es in Berkeley keine obdachlosen Familien. Wurde gerade wieder veröffentlicht. Aber ich bin doch hier mit Theo! Und sie kennen mich!“
Leah kämpft. Und sie ist realistisch. Im vergangenen Jahr hatten sie und Theo schon 2x Lungenentzündung, einmal im Februar, einmal im Juli. „Wenn wir nicht bald eine Wohnung bekommen, stirbt mir mein Sohn.“